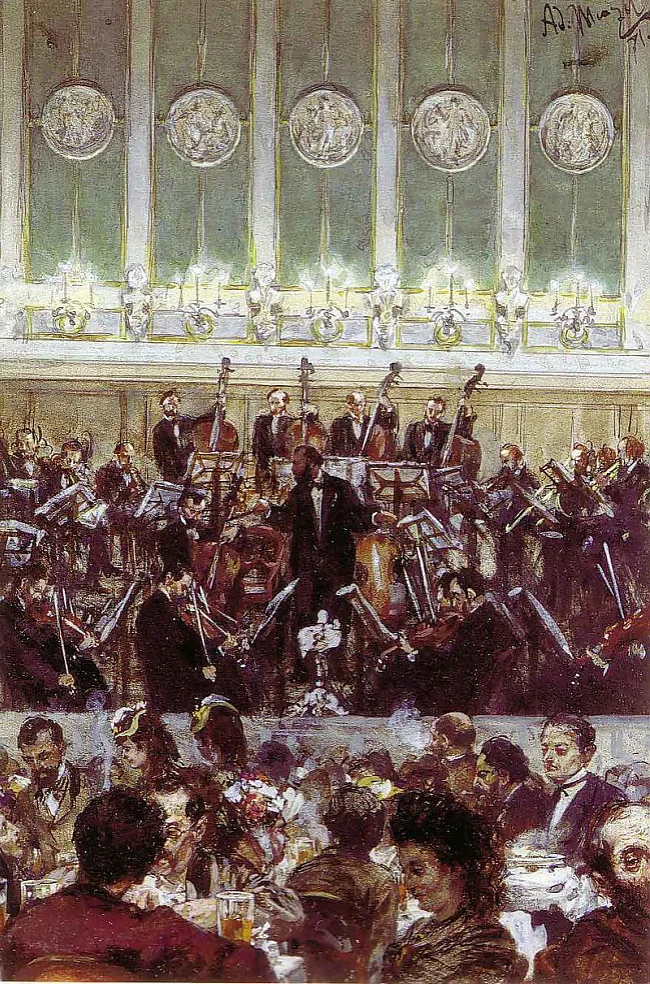
Schlesien wurde von Vandalen, Slawen, Deutschen und Holländern besiedelt, war Böhmen und Polen untertan, Tschechien erhob Ansprüche, und Preußen annektierte Landesteile. Was also ist ein Schlesier? Und wie sieht eine schlesische Kultur aus? Das sind hinterlistige Fragen, die man nicht sinnvoll beantworten kann. Aber es lassen sich etwa Komponisten benennen, die in Schlesien geboren wurden oder dort tätig waren. Matthias Buth beschreibt das Musikleben an der Oder als ein europäisches.
„Die Poesie hat sich auf einige Augenblicke in der Ewigkeit die Maske der Ironie vorgebunden, um ihr Schmerzensgesicht nicht sehen zu lassen; vielleicht dass die freundliche Hand eines Genius sie einmal abbinden wird.“ Das ist ebenso zauberhaft wie innig und vor allem stimmig. Robert Schumann entfaltete 1835 in einer an Jean Paul geschulten Sprache die Symphonik von Hector Berlioz und geht so zusammen mit dem geneigten Leser durch das fünfgeschossige Klanggebäude der „Symphonie fantastique“, seinem Opus 14 aus Jahre 1830. In Bonn am Rhein, im Alten Friedhof liegt dieser große Musikpoet, der Intellektuelle und Romantiker in einem, begraben. Ihm zur Seite Clara, die Angebetete und Muse, die Veredlerin seiner Musik. Aber er kam aus dem sächsischen Zwickau, das zum Königreich Sachsen gehörte. Und als er in einem langen Essay die Musik des großen Franzosen entschlüsselte, war Robert Schumann gerade mal 25 Jahre alt, der in Leipzig seine Persönlichkeit in die Traumgestalten Eusebius und Florestan projektierte. Und der (Gott sei Dank) verhinderte Jurist, den Friedrich Wieck als Pianist unterrichtete, war umfassend gebildet und zwar in der Musik und in der Literatur. Wer einen Vater als Verleger hat, ist den Bücherwelten näher als anderen.
Und er wusste, dass am ehesten Berlioz als Symphoniker dem titanischen Beethoven ein Nachfolger sein konnte (Brahms hatte seine vier Symphonien noch nicht geschrieben). Im Anfangsteil des Aufsatzes streift er beherzt und kundig über die Werke der Tonsetzer der 30er Jahre des 19., des so überaus musikalisch-deutschen Jahrhunderts. „Spohr, dessen zarte Rede in dem großen Gewölbe der Sinfonie, wo er sprechen sollte, nicht stark genug widerhallte. Kalliwoda, der heitere, harmonische Mensch, dessen späteren Sinfonien bei tieferem Grunde der Arbeit die Höhe der Phantasie seiner ersten fehlte. Von Jüngeren kennen und schätzen wir noch L. Maurer, Fr. Schneider. I. Moscheles, Ch. G. Müller, A. Hesse, F. Lachner und Mendelssohn, den wir geflissentlich zuletzt nennen.“ Um die Großen, um die Genies, scharte sich immer eine große Zahl von Könnern, deren Werke hohen Rang hatten und behielten, aber eben nicht jene Gipfelhöhen erreichen, von denen wir in weite Horizonte und zugleich in unsere innersten Seelentiefen schauen können.
In Franz Schubert erkannte Schumann noch jemanden, der an den „alten Formen etwas Wesentliches zu verändern gewagt“ habe, aber dennoch ist es von Gewinn, sich der Musik um Schumann und um Mendelssohn, später den Kreisen um Brahms und Bruckner zuzuwenden und auch nach Osten zu schauen, in jenen Teil Europas, der durch die Grenzänderungen infolge des Zweiten Weltkrieges seinen Klang und Resonanzboden für die Musikkultur im Dreiländereck Deutschland – Tschechien – Polen nicht verloren hat.
Wer weiß noch etwas von Otto Beständig, der 1835 im schlesischen Striegau geboren und 1917 in Wandsbek (heute in Hamburg) begraben wurde, wer etwas von seinen zahlreichen Oratorien, so von „Salomons Tempelweihe“ und „Der Tod Baldurs“ oder gar von seinen Symphonien, Chören und Liedern? Der Kirchenmusiker Moritz Brosig blieb sein ganzes Leben in Schlesien (geb.1815 in Fuchswinkel bei Neiße und 1887 gestorben in Breslau). Er war von 1853 bis 1884 Domorganist und Domkapellmeister im Breslauer Dom. In dieser Zeit entstanden neun Messen, zahlreiche Orgelwerke, er schrieb auch für Cello und Klavier und trat akademisch mit einer „Modulations-Theorie“ und einer „Harmonielehre“ hervor. Von 1834 bis 1838 war der 1817 in Breslau zur Welt gekommene Eduard Frank Schüler von Felix Mendelssohn-Bartholdy in Düsseldorf, ein beachtlicher Symphoniker (fünf Symphonien), dessen Kammermusik in Trio- und Quintett-Besetzungen wieder mehr Beachtung findet, so seine innige Sonate in F-Moll (Opus 42) für Cello und Klavier. Er gehörte zum Freundeskreis um Schumann, der ihm schon in den „Zwölf Studien für das Pianoforte“ (Opus 1) „Ernst der Ansicht, Kunstmäßigkeit des Satzes“ sowie „Leichtigkeit der Kombination“ bescheinigte. Die Musikhochschule zu Köln bewahrt dem alten Lehrer der „Rheinischen Musikschule“, die in der Hochschule aufgegangen ist, weiterhin Anerkennung, denn von 1851 an lehrte er am Rhein Klavier, Partiturspiel und Musiktheorie. Nachdem er nicht Schumann als Städtischer Musikdirektor in Düsseldorf folgen konnte, ging er 1859 nach Bern, dann nach Berlin ins „Sternsche Konservatorium“, um 1878 in Breslaus Konservatorium bis zum Jahre 1892 zu wirken; ein Jahr später verstarb der schlesische Komponist und Lehrer in Berlin.
Wer den Namen J.H. Franz hört, wird vielleicht an den Pianisten und Festivalgründer in Schleswig-Holstein und Mecklenburg denken, der auch mit den Sendungen „Achtung Klassik“ im ZDF von sich reden machen, also an Justus Frantz denken und meinen, die Schreibweise sei nicht richtig, aber gefehlt: Es ist ein Name mit schlesischem Klang und Ausstrahlung. Auf Schloss Fürstenstein wurde er geboren. Und wer 1834 in einem so imponierenden Gebäude zur Welt kommt, kann nicht Franz heißen. Und so ist es: Sein vom Pseudonym befreiter Name ist Hans Heinrich XIV. Bolko Graf v. Hochberg. Er fühlte sich Schumann nah, und seine drei Symphonien, das Klavierkonzert sowie Kompositionen für die Bühne wie „Der Währwolf“ und „Die Falkensteiner“ lassen dies erkennen. Er war Musiker, Intendant am Preußischen Hoftheater (1886 bis 1903), auch Diplomat und ist wie sein ferner und späterer (Fast-) Namensvetter als Musikmanager nachdrücklich in Erinnerung, nämlich durch die Gründung des „Schlesischen Musikfestes“ im Jahre 1876.
Zu den Komponisten, die Schumann schätzte und im Berlioz-Artikel erwähnte, gehörte auch der 1809 in Breslau geborene Adolf Friedrich Hesse, der in seiner Heimatstadt als Musikdirektor und Dirigent des Breslauer Symphonieorchesters wirkte und seit 1831 in Sankt Bernhardin als Organist. Sein Oratorium „Tobias“ sollte ebenso wiederentdeckt werden wie sein umfangreiches Orgelwerk sowie die sechs Symphonien, die Ouvertüren, Motetten und Kantaten.
Auch Grottkau liegt in Schlesien. Dort kam 1766 ein Musiker zur Welt, der mehr als Lehrer in Erinnerung ist denn als Komponist von acht Symphonien, Bühnenmusik und 14 Opern. Wer kennt noch die Opern „Die vier Zauberkugeln“, „Das Echo der Wälder“, „Die Mädchen von der Weichsel“ und die Schrift „Inwieweit die polnische Sprache zur Musik geeignet sei“ aus dem Jahre 1803? Der Komponist ist Josef Xaver Elsner, der Lehrer von Frédéric Chopin. Seine musikalische Ausbildung erhielt er 1781 in Breslau, wirkte lange in Warschau und ab 1821 im dortigen Konservatorium. Ohne Elsner kein Chopin. Dem fast Gleichaltrigen war Schumann immer nah, der ihm im „Carnaval“ Opus 9 ein musikalisches Denkmal setzte.
Wer den Namen Gleiwitz hört, zuckt immer noch zusammen und denkt an den „Sender Gleiwitz“, an den angeblichen Überfall polnischer Truppen, der Deutschland und der Wehrmacht den Vorwand zum Überfall auf Polen dienen sollte. Aber von dort kam ein wunderbarer Musiker, der Oberschlesier Richard Wetz, 1875 wurde er dort geboren und starb 1935 in Weimar. Seine drei Symphonien sind nun als CD erhältlich und lassen einen Komponisten erleben, der spätromantische Klangwelten erschließen kann, die auch in die Opern „Das ewige Feuer“ und „Judith“ mitnehmen. Neben zahlreichen Liedern sind seine beiden Streichquartette fesselnde Klänge, die an die suggestive Musik von Alexander von Zemlinsky heranreichen.
Für die Neiße-Stadt Görlitz hat Reinhold Fleischer immer noch einen guten Klang. Dort starb der Romantiker 1902. Er wurde 1842 in Dahsau bei Herrnstadt in eine evangelische Familie hineingeboren, ließ sich in Berlin im Königlichen Institut für Kirchenmusik und in der ebenso Königlichen Akademie der Künste zum Organisten ausbilden. Ab 1870 schlug er die Orgel in der Görlitzer Hauptkirche und leitete die Singakademie und stieg 1885 zum Königlichen Musikdirektor auf. Seine Symphonien – vor allem jene in C-Moll – zu entstauben und ins Konzert zu bringen, sollte sich die Stadt Görlitz vornehmen und damit die restaurierte Stadthalle wiedereröffnen. Dies wäre eine Tat, die ganz dem Vermächtnis von Ulf Grossmann entspräche, dem langjährigen Kulturbürgermeister der Stadt, der 2020 viel zu früh verstarb und dem dieser schlesischer Meister auch als Chordirigent nahe war, nicht zuletzt auch im Hinblick auf das Oratorium „Adoramus te“ für gemischten Chor.
Musik öffnet Horizonte und sie braucht ein weites Feld, auf dem viele Meister in unterschiedliche Dimensionen hinaufwachsen können. Viele Musiklandschaften waren und sind so bedeutend, weil sie nicht auf ein nationales Idiom gebracht werden können. Komponisten wollen die Welt erreichen, zu ihr sprechen. Manchen ist es gelungen, anderen nur in einzelnen Werken. Diese wieder zu entdecken und einem größeren Publikum zu Gehör zu bringen, ist immer eine staatliche und kommunale Aufgabe im europäischen Geiste. Und immer geht es um das Werk, um das Kunstwerk. Dieses hat sich zu beweisen.
Und so ist in Polen, in Tschechien und Deutschland auch schlesische Musik und Musikkultur wiederzuentdecken ohne politischen Impetus, sondern aus der Erleuchtung, die in Klängen und Klagen möglich ist und so in der Hoffnung, den inneren Kosmos in jedem Zuhörer zu erfüllen. Das Lausitz Musikfestival, zu dem sich das Land Brandenburg und der Freistaat Sachsen 2020 verbunden haben mit Daniel Kühnel an der Spitze, weiß es längst und wird alle Chancen wahrnehmen, vor allem unsere EU-Partner zu einem musikalischen Dreiklang zusammenzubringen. Das sollte gelingen. Denn Musik ist das innere Vaterland Europas.
Letzte Änderung: 09.04.2024 | Erstellt am: 05.04.2024